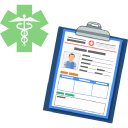Wer schon einmal eine Krankmeldung für die Schule oder den Arbeitgeber abgegeben hat, hat vielleicht eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen auf der Ausfertigung für die Krankenkasse bemerkt.
Hierbei handelt es sich um den Diagnoseschlüssel, der genau auf die jeweilige Bezeichnung verweist. Man findet diese Diagnoseschlüssel in einem weltweit anerkannten System, anhand dessen Fachleute medizinische Diagnosen einheitlich benannt haben.
Ziel der Diagnostik ist eine Zuordnung der Beschwerden, das Erkennen von Zusammenhängen, und natürlich das Finden einer Lösung. Damit die Zuordnung einheitlich ist, wird die Diagnose also codiert angegeben; die Krankenkasse kann dies dann eindeutig anhand des ICD-Diagnosehandbuchs zuordnen. Als Patient sieht man den Schlüssel meist auf Attesten, Krankmeldungen oder auch im abschließenden Bericht der Untersuchungen oder einer Therapie.
Es gibt das internationale ICD der WHO, und das US-amerikanische DSM:

ICD steht für:
“International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”, also „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsproblem“.
Die aktuelle Fassung wurde am 01.01.2022 veröffentlicht, wodurch auch in Deutschland nun die Autismus-Spektrum-Störung statt der einzelnen, voneinander getrennten Formen gilt.
Die Autismus-Formen im ICD-10 (F.84-)
Die Gruppe der Diagnoseschlüssel F80 bis F89 behandelt Entwicklungsstörungen. Sie haben Folgendes gemeinsam:
- Sie beginnen im Kleinkind- oder Kindesalter
- Sie beschreiben eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen der biologischen Reifung des Zentralnervensystems
- Und sie haben einen stetigen Verlauf ohne Remissionen und Rezidive
Remission = vorübergehendes Nachlassen von Symptomen
Rezidive = Rückfall bei einer Krankheit, die als geheilt gesehen wurde
Bei Entwicklungsstörungen sind meist folgende Bereiche betroffen:
- Sprache (zum Beispiel verbale Kommunikation)
- Soziale Interaktion (also der Umgang mit anderen Menschen)
- Visuell-räumliche Fähigkeiten (die Fähigkeit, sich Bilder mental vorzustellen)
- Motorik / Bewegungskoordination
- Interessen und Verhaltensweisen
Während Kinder ihre Fähigkeiten normalerweise in bestimmten Jahren entwickeln, kann das bei einer vorliegenden Entwicklungsstörung zeitlich verzögert vorkommen, oder sich gar nicht erst in dem normalen Ausmaß entwickeln. In späteren Jahren kann sich die Entwicklung an den normalen Stand anderer Kinder gleichen Alters anpassen, oder bestehen bleiben.
Da häufig weitere Beeinträchtigungen oder Erkrankungen vorliegen, kann es mit zunehmendem Alter schwieriger werden, zu differenzieren. In einigen Fällen lernen die Betroffenen, sich damit zu arrangieren, und Einschränkungen fallen weniger auf. Daher ist die nachträgliche Diagnostik im Erwachsenenalter auch oftmals so schwierig.
F84.0 Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom)
Der frühkindliche Autismus zeigt sich vor dem dritten Lebensjahr, und betrifft neben den oben genannten Bereichen oft vor allem die Sprachentwicklung. Ungefähr 50-70% der Betroffenen haben zudem eine Intelligenzminderung, das heißt einen IQ von unter 70, und 30-50% kommunizieren nicht oder nur eingeschränkt verbal.
Unterstützung ist durch frühzeitiges Erkennen und eine individuelle Förderung möglich. Auch wenn man nicht verbal, also durch Sprache kommuniziert, findet trotzdem meist eine Kommunikation statt. Manche Betroffene drücken sich zum Beispiel schriftlich, durch Gesten oder durch Berührungen aus.
Schon gewusst? Neben der bekannten Zeichen- bzw. Gebärdensprache gibt es auch die sogenannte Unterstützte Kommunikation: Flyer von Autismus e.V.
F84.1 Atypischer Autismus
Der atypische Autismus ist gewissermaßen eine Zwischenform der anderen beiden Formen. Hier tritt der Autismus später auf als beim frühkindlichen Autismus, und es sind nicht alle Diagnostikkriterien erfüllt.
Allerdings liegt auch hier eine sprachliche oder kognitive Einschränkung vor, anders als beim Asperger-Syndrom.
F84.5 Asperger-Syndrom
Beim Asperger-Syndrom ist die sprachliche und kognitive Entwicklung meist nicht verzögert und kaum eingeschränkt. In manchen Fällen findet die Sprachentwicklung sogar früher statt als gewöhnlich, und es wird eine eher erwachsenenhafte Sprache genutzt.
Die Autismus-Spektrum-Störung im ICD-11 (6A02)

DSM steht für:
“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, also „Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen“.
Die aktuelle Version ist das DSM-5, dessen Diagnosekriterien oftmals parallel zu denen des ICD herangezogen werden.
Die Diagnosekriterien des DSM 5 finden primär in den USA Anwendung, aber auch in Deutschland wird teilweise parallel nach DSM 5 diagnostiziert.
In den vergangenen Jahren wurde mehrmals kritisiert, dass die Diagnosekriterien und die Aufnahme von neuen Diagnosen nicht objektiv sei. Im März 2022 wurde zudem eine Petition gestartet, dass der Abschnitt zur Autismus-Spektrum-Störung erneut überarbeitet werden soll. Grund dafür ist, dass die Kriterien zu streng definiert worden seien.
Der amerikanische Psychiater Dr. Michael B. First, der an der Erarbeitung der aktuellen Version gearbeitet hat, sagte in einem Interview:
Die Herausforderung besteht darin, dass die Autismus-Spektrum-Störung in den letzten 10, 15 Jahren auf großes Interesse gestoßen ist, weil die Zahl der Fälle von Autismus-Spektrum-Störung scheinbar explosionsartig gestiegen ist. Zum Teil wird argumentiert, dass die Menschen die Störung besser erkennen und es deshalb mehr Fälle gibt, zum Teil ist es aber auch ein Übermaß an Anerkennung. […] Es hat sich also in die Sprache eingebürgert. Aber es zeigt auch, dass es überstrapaziert und überdiagnostiziert wurde. […] Die neue Version enthält nun ganz klar alle der folgenden Punkte.
Während zuvor also nur teilweise die Bereiche erfüllt sein mussten, so müssen nun alle erfüllt sein. Das steht dem allgemeinen wissenschaftlichen Verständnis entgegen, laut dem Autismus eben ein Spektrum ist – er äußert sich bei jedem anders, und nicht bei allen sind alle Einschränkungen und Besonderheiten gegeben.
Die derzeitige Definition lautet seitdem wie folgt:
“Um die Diagnosekriterien für ASD gemäß DSM-5 zu erfüllen, muss ein Kind anhaltende Defizite in jedem der drei Bereiche der sozialen Kommunikation und Interaktion (A.1. bis A.3.) sowie mindestens zwei von vier Arten von eingeschränkten, sich wiederholenden Verhaltensweisen (B.1. bis B.4.) aufweisen.”
Zudem wird bei der Diagnose in jedem Bereich ein Schweregrad definiert, der Aufschluss gibt, wie viel Unterstützung notwendig ist: Stufe 1: erfordert Unterstützung Stufe 2: erfordert umfangreiche Unterstützung Stufe 3: erfordert sehr umfangreiche Unterstützung
Bereich A
Anhaltende Defizite in sozialer Kommunikation und sozialer Interaktion
(Alle drei Teilbereiche müssen zutreffen)
- Defizite in der sozial-emotionalen Reziprozität Beispiele: Kontaktaufnahme zu anderen, Inganghalten von Gesprächen, Teilen von Interessen, Ausdruck von Emotionen die zur Situation passen
- Defizite bei nonverbalen kommunikativen Verhaltensweisen für soziale Interaktion Beispiele: Keine oder wenig verbale Kommunikation, unpassende nonverbale Kommunikation wie Gesichtsausdrücke, ungewöhnliche Aufnahme von Blickkontakt (wenig, gar nicht, oder Anstarren), ungewöhnliche Verwendung von Gesten
- Defizite bei Entwicklung, Aufrechterhaltung und Verständnis von Beziehungen Beispiele: Schwierigkeiten bei der Verhaltensanpassung an die Situation, kein Spielen mit anderen Kindern, Probleme mit Teamarbeit, mangelndes Interesse an Gleichaltrigen
Bereich B
Eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten
(Mindestens zwei Teilbereiche müssen zutreffen)
- Stereotype oder sich wiederholende motorische Bewegungen oder Sprache Beispiele: Stimming, Aufreihen oder Sortieren von Spielzeug, Echolalie (Wiederholung von Worten oder Sätzen), Wortneuschöpfungen, Dinge wörtlich nehmen
- Festhalten an Routinen Beispiele: Extreme Stressreaktion bei kleinen Veränderungen, Probleme mit neuen Situationen oder Übergangen, starre Denkmuster, Begrüßungsrituale, Laufen gleicher Wege, Essen gleicher Gerichte oder Nahrungsmittel
- Stark eingeschränkte Interessen mit ungewöhnlicher Intensität Beispiele: Starke Bindung an Gegenstände, Beschäftigung mit ungewöhnlichen Objekten oder Texturen, Spezialinteressen im Allgemeinen
- Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen Beispiele: In Bezug auf Schmerzen, Temperaturen, Geräusche, Gerüche, Licht, Texturen wie zum Beispiel Holz oder Kleidung
Bereich C
Die Symptome müssen in der frühen Entwicklungsphase vorhanden sein (sie können sich aber auch erst dann zeigen, wenn die sozialen Anforderungen die Fähigkeiten übersteigen, oder sie können durch erlernte Strategien im späteren Leben unauffällig bleiben).
Bereich D
Die Symptome führen zu klinisch bedeutsamen Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen.
Bereich E
Diese Störungen lassen sich nicht besser durch eine geistige Behinderung (intellektuelle Entwicklungsstörung) oder eine globale Entwicklungsverzögerung erklären. Eine geistige Behinderung und eine Autismus-Spektrum-Störung treten häufig gemeinsam auf; um ein paralleles Auftreten von Autismus-Spektrum-Störung und geistiger Behinderung zu diagnostizieren, sollte die soziale Kommunikation unter dem für das allgemeine Entwicklungsniveau erwarteten Niveau liegen.
Zudem enthält das DSM 5 den folgenden Hinweis:
Bei Personen mit einer gut etablierten DSM-IV-Diagnose einer autistischen Störung, einer Asperger-Störung oder einer nicht anderweitig spezifizierten tiefgreifenden Entwicklungsstörung sollte die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung gestellt werden. Personen, die ausgeprägte Defizite in der sozialen Kommunikation aufweisen, deren Symptome aber ansonsten nicht die Kriterien für eine Autismus-Spektrum-Störung erfüllen, sollten auf eine soziale (pragmatische) Kommunikationsstörung untersucht werden.
Abschließend wird bei der Diagnostik angeben, ob folgende Kriterien zutreffen:
- Mit oder ohne begleitende intellektuelle Beeinträchtigung
- Mit oder ohne begleitende Sprachbeeinträchtigung
- In Verbindung mit einem bekannten medizinischen oder genetischen Zustand oder Umweltfaktor
- In Verbindung mit einer anderen neurologischen Entwicklungsstörung, psychischen Störung oder Verhaltensstörung
- Mit Katatonie